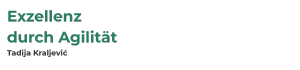Warum haben sich digitale Technologien so rasant verbreitet? Ganz einfach: Sie liefern uns entweder einen klaren Nutzen, lösen ein drängendes Problem – oder unterhalten uns. Oft sogar alles zugleich. Genau das macht ihre Anziehungskraft aus. Hinzu kommt ihre digitale „Natur“: Sie lassen sich in Lichtgeschwindigkeit verbreiten.
Die Forscher Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee vom Massachusetts Institute of Technology benennen drei zentrale Treiber dieser Entwicklung: exponentielles Wachstum, Economies of Digitization und Kompatibilität. Wir ergänzen diesen Dreiklang um einen vierten Faktor: die Vernetzung.
Exponentielles Wachstum
Oft wird in diesem Zusammenhang das sogenannte Moore’sche Gesetz zitiert: „Die Anzahl der Transistoren auf einem Mikrochip verdoppelt sich etwa alle zwei Jahre, während die Kosten pro Transistor sinken.“ Das bedeutet: Immer mehr Rechenleistung für immer weniger Geld.
Ein Beispiel: Der Intel 4004-Chip aus dem Jahr 1971 hatte 2.300 Transistoren. Im Jahr 2000 waren es beim Pentium 4 bereits 42 Millionen – und 2023 kam der AMD Epyc Genoa Chip auf über 90 Milliarden Transistoren.
Auch beim globalen Datenvolumen zeigt sich dieses Wachstum: Der Anteil digital gespeicherter Informationen stieg laut Hilbert & Lopez von 3 % (1993) auf 94 % (2007). 2020 wurden 64,2 Zettabyte an Daten erzeugt. Für 2027 prognostiziert Statista bereits 284 Zettabyte.
Economies of Digitization
Digitale Güter unterscheiden sich grundlegend von physischen Produkten: Einmal erstellt, lassen sie sich nahezu kostenlos und verlustfrei beliebig oft kopieren. Diese Null-Grenzkosten machen digitale Produkte extrem skalierbar.
Ein anschauliches Beispiel: Bis eine Technologie weltweit 50 Millionen Nutzer erreichte, dauerte es beim Telefon 75 Jahre, beim Fernsehen 13 Jahre und beim Handy 12 Jahre. Facebook brauchte dafür nur 3 Jahre, Pokémon Go nur 19 Tage.
Jeremy Rifkin nennt dieses Phänomen „Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft“. Sie stellt klassische Geschäftsmodelle infrage – denn neue Anbieter mit starker IT-Kompetenz können mit minimalen Kosten ganze Branchen herausfordern.
Kompatibilität digitaler Systeme
Digitale Systeme können sich gegenseitig ergänzen und verstärken – durch offene Schnittstellen und APIs.
Beispiel: Smartphones ermöglichen mobiles Shopping, KI wertet Sensordaten in Echtzeit aus, Zahlungsdienste wie PayPal lassen sich mühelos in Webshops einbinden.
Kompatibilität bedeutet also: Prozesse greifen ineinander. Systeme arbeiten zusammen. Innovation wird beschleunigt.
Vernetzung
Die logische Folge der Kompatibilität ist die Vernetzung – der wahre Verstärker des digitalen Wandels.
Erst durch globalen Datenaustausch entsteht die Dynamik, mit der neue Produkte und Geschäftsmodelle entstehen und sich rasend schnell verbreiten. Maschinen kommunizieren untereinander. Menschen vernetzen sich mit anderen Menschen – und mit Maschinen.
Vernetzung ist längst nicht mehr nur ein technisches Konzept. Sie prägt Wirtschaft, Gesellschaft und Kommunikation. Durch Netzwerkeffekte wird aus linearer Entwicklung exponentielles Wachstum.
Fazit
Die vier Treiber – exponentielles Wachstum, Null-Grenzkosten, Kompatibilität und Vernetzung – erklären, warum sich digitale Innovationen so unwiderstehlich verbreiten. Wer sie versteht, erkennt nicht nur die Logik hinter disruptiven Veränderungen, sondern auch die Chancen, die darin liegen.
Wie geht es weiter?
In kommenden Beiträgen schauen wir uns an, was diese vier Treiber des digitalen Wandels für agiles Denken und Handeln bedeuten – und wie Unternehmen sie in exzellente Praxis übersetzen können.
Wenn du keinen Beitrag verpassen willst, abonniere gerne den Blog oder folge mir auf LinkedIn.